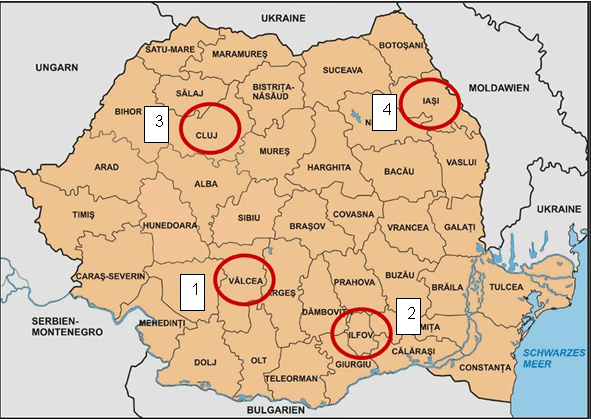F&E Schiffsabwasserbehandlung
Schiffsabwasserbehandlung
Development of a “Best Practice Guidance for the handling of wastewater in Ports" for the Special Area Baltic Sea - Abschluss: 2018
Funded by:
Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH)
Project duration:
April 2017 – November 2018
Content:
Eutrophication is one of the main threats to the biodiversity of the Baltic Sea and is caused by excessive input of nutrients to the marine environment. A part of the nutrient input originates from shipping. From 2000 to 2014, the number of cruise passengers in the Baltic Sea has increased by almost 250%, as well as cruise ship calls by 53% (Cruise Baltic Statistics 2014). As a consequence, the Baltic Sea has been designated as first MARPOL Annex IV Special Area at the initiative of HELCOM. Passenger ships intending to discharge sewage within the Special Area have to comply with more stringent regulations on nitrogen and phosphorous removal. The requirements can be met by either installing advanced wastewater treatment systems or discharging the sewage to port reception facilities (PRF). This creates challenges for the Baltic ports, shipping companies and municipal wastewater treatment plants. Therefore the Federal Maritime and Hydrographic Agency of Germany (BSH) commissioned this project on the development of a “Best Practice Guidance for the Handling of Wastewater in Ports”, which will provide information and concrete guidance for involved parties and HELCOM member states.
As a first step, the development of the “Best Practice Guidance” requires a comprehensive collection of data. This includes the review of existing reports and literature, as well as the generation of new data from surveys conducted within the project. Then, the review and evaluation of the whole data set will allow for a comprehensive understanding of the current state of PRFs within the HELCOM area and the needs of the shipping industry and related challenges. Based on this input, practical solutions and approaches will be developed and outlined in the guidance document. The different stakeholder groups, such as ports, shipping companies and municipal waste water treatment plants, and the HELCOM member states are actively involved in the process. For example, the project outline and a progress report will be presented at the HELCOM Cooperation Platform on Port Reception Facilities in September 2017 and the HELCOM Maritime meeting in October 2017 for comments and further suggestions.
The goal of the project is to provide concrete and practical guidance to improve the handling of wastewater in ports in order to face the rising challenges.
Key of the present study is the specific information exchange of all involved parties (ports, shipping companies and municipal wastewater treatment plants), as so far many relevant studies consider only one part of the wastewater reception and treatment process.
For example, the growing number of cruise ships lead to higher infrastructural demands in ports, i.e. the industry requests adequate port reception facilities which are able to receive the wastewater without prolonging the stay of the vessels in the port (HINTZSCHE, 2016).
In order to prevent hydraulic overload, however, the ports are not allowed to discharge an undetermined amount of sewage in the sewer network. Therefore, municipal authorities must be included in the development process (GÜLDENZOPH, 2016).
Finally, surveys of all significant parameters and the report Baltic Sea Sewage Port Reception Facilities (HELCOM Overview 2014) show that there are challenges regarding the first time reception of wastewater in ports. The wastewater composition on board of a cruise ship differs strongly and cannot be considered as a constant parameter (DORGELOH, 2016). The strong differences result from separate grey and black water collection and treatment methods on board.
Dependent on possible different wastewater composition the “Best Practice Guidance” will identify specific instructions on how to deal with potential problems concerning the reception, handling and treatment. In addition, it will also highlight technical solutions regarding pre-treatment at ports.
The final document will be presented at HELCOM Maritime in autumn 2018.
Sources:
HELCOM 2014: HELCOM Overview 2014, Baltic Marine Environment Protection Commission Baltic Sea Sewage Port Reception Facilities
HINTZSCHE 2016: Workshop on port reception facilities, W. Hintzsche, German Shipowners‘ Association, PRF acc. MARPOL IV Special Area – Ferry Operators‘s perspective
GÜLDENZOPH 2016: Workshop on port reception facilities, W. Güldenzoph, The greatest challenges of PRFs - a wastewater system operator’s perspective
DORGELOH 2016: Workshop on port reception facilities, E. Dorgeloh, Challenge of sewage treatment ashore
Contact:
prf@pia.rwth-aachen.de
Entwicklung und Praxistests von Membranmodulen zur Überschussschlammminimierung für die stoffstromorientierte Abwasserentsorgung auf Flusskreuzfahrtschiffen - Abschluss: 2018
Gefördert durch:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück
Projektlaufzeit:
September 2016 bis September 2018
Inhalt:
Zielsetzung und Anlass des Vorhabens
Ziel des Projektes war es, ein Membranmodul zu entwickeln, mit dem die Menge an Überschussschlamm, der beim Betrieb von Bordkläranlagen auf Flusskreuzfahrtschiffen anfällt, durch Aufkonzentration zu minimieren. Zusätzlich sollten Schlammdesintegrationseffekte zur Mengenminimierung genutzt werden.
Auf Flusskreuzfahrtschiffen werden die an Bord entstehenden häuslichen Abwässer zur Einhaltung umweltgesetzlicher Bestimmungen der Binnenschifffahrt (CDNI-Übereinkommen) mittels Bordkläranlagen behandelt. Das behandelte Abwasser wird in die Wasserstraße eingeleitet. Der beim Behandlungsprozess entstehende Klärschlamm muss zwischengespeichert und intervallweise an Entsorgungsfahrzeuge an Land abgegeben werden. Eine Minimierung der Schlammmengen führt somit zu einer deutlichen Verringerung von Tankwageneinsätzen und gleichzeitig zu Einsparungen von Entsorgungskosten.
Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden
Die Entwicklung des Membranmoduls erfolgte unter Einsatz einer Versuchsanlage an Land. Die Untersuchungen konzentrierten sich auf Leistungskenndaten des Moduls und auf die Reduktion der Klärschlammmengen. In verschiedenen Betriebsphasen wurde das Filtrat des Schlammmoduls dem Zulauf oder dem Ablauf der Versuchskläranlage zugeleitet und die Auswirkungen auf die Ablaufqualität untersucht. Es wurde getestet, inwieweit durch Neuparametrierungen der Anlagensteuerung (Phasen mit/ohne Belüftung) eine zusätzlich zu erwartende Stickstofffracht im Ablauf reduziert werden kann. Die Möglichkeit einer Fällmittelzugabe in den Schlammsammeltank zur Fixierung rückgelösten Phosphors war ebenfalls Bestandteil der Versuche.
Parallel zu den Landversuchen wurde ein Prototyp des Membranmoduls in den Schlammsammeltank eines Flusskreuzfahrtschiffes installiert, um Langzeiterfahrungen zur Betriebsstabilität und Dauerhaftigkeit der eingesetzten Materialien unter Realbedingungen zu gewinnen. Der Praxisbetrieb wurde technisch und wissenschaftlich begleitet. Die Begleitungen umfassten regelmäßige Vor-Ort-Kontrollen und eine Beprobung aller relevanten Messstellen in den Zu- und Abläufen der Bordkläranlage und des Schlammsammeltanks.
Die gewonnenen Ergebnisse wurden abschließend in Empfehlungen zum Einsatz des Membranmoduls für die Kreuzfahrtbranche zusammengefasst.
Projektpartner:
Martin Membrane Systems AG
Demonstrationsprojekt "Großtechnischer Betrieb von Membrananlagen auf Fahrgastbinnenschiffen" an Bord der MS RheinEnergie - Abschluss: 2006
Gefördert durch:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen (MUNLV NRW)
Projektlaufzeit:
Januar 2005 – Dezember 2006
Inhalt:
Inhalte des Forschungsvorhabens waren die wissenschaftliche Begleitung des großtechnischen Betriebes einer Schiffskläranlage mit Membranfiltration auf dem Tagesausflugsschiff RheinEnergie der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG. Ziele des vorliegenden Projektes waren eine Ermittlung von Bemessungsgrößen zur Dimensionierung von Bordkläranlagen für Fahrgastbinnenschiffe, eine Ermittlung erreichbarer Eliminationsleistungen und einzuhaltbarer Grenzwerte sowie Untersuchungen zu Klärschlammspeicherungsmöglichkeiten an Bord und Schlammabgabe an Land.
Die Schiffskläranlage vom Typ siClaro-BMA®- Abwasserbehandlungsanlage der Firma Martin Systems AG aus Sonneberg/Soest basierte auf dem Membranbelebungsverfahren. Die Anlage bestand aus einer mechanischen Vorreinigung zur Grobstoffabscheidung durch Feinsiebung, dem BMA®-Biomembranreaktor zur biologischen Behandlung des vorgereinigten Abwassers und einer Membrantrennstufe bestehend aus getauchten Ultrafiltrationsmembranen. Schiffseitige Abwasserspeichertanks waren der Anlage vorgeschaltet.
Veranlassung des Forschungsvorhabens war ein zukünftiges Einleitverbot von unbehandelten häuslichen Abwässern in die Bundeswasserstraßen für Fahrgastbinnenschiffe. Das Einleitverbot ist im „übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt“ der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) geregelt. Das übereinkommen wird voraussichtlich 2008/2009 in Kraft treten.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Anlagenbetriebs konnte festgestellt werden, dass im Ablauf der Schiffskläranlage die geforderten Ablaufgrenzwerte der ZKR für die Parameter CSB und BSB5 eingehalten wurden. Im Mittel betrugen die CSB-Ablaufkonzentrationen 45 mg/l, die maximale Ablaufkonzentration von 93 mg/l lag noch deutlich unter dem zulässigen Grenzwert nach dem Übereinkommen der ZKR von 180 mg/l. Gleiches konnte für den Parameter BSB5 festgestellt werden. Die mittlere Ablaufkonzentration wurde zu 2 mg/l ermittelt, die maximale Ablaufkonzentration von 9 mg/l lag auch hier deutlich unter dem zulässigen Grenzwert von 40 mg/l. Die Untersuchungen zu erreichten Eliminationsleistungen ergaben eine Eliminationsleistung für den Parameter CSB von 96,9 % und für den Parameter BSB5 von 99,7 %. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass unter der Voraussetzung einer sorgfältigen Betriebsüberwachung (Routinekontrollen durch Betreiber; regelmäßige Anlagenwartung durch Anlagenhersteller), die Abwasserbehandlung durch Schiffskläranlagen an Bord von Tagesausflugsschiffen technisch möglich ist und somit eine Alternative zur Abwasserspeicherung und Abwasserabgabe an Land darstellt. Bei unbehandelter Einleitung des an Bord anfallenden Abwassers werden pro Hauptsaison etwa 5 Tonnen CSB-Frachten und 2,6 Tonnen BSB5-Frachten von der RheinEnergie in die Wasserstraße eingeleitet. Mit den erreichten Eliminationsleistungen können die eingeleiteten Frachten für den Parameter CSB auf 155 kg und für den Parameter BSB5 auf etwa 8 kg in der Hauptsaison reduziert werden.
Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG wird den Betrieb der Membran-Schiffskläranlage auch nach Beendigung des Forschungsvorhabens in Eigenregie fortzusetzen. Damit konnte das Ziel erreicht werden, die Membrantechnik in Schiffskläranlagen für Fahrgastbinnenschiffe als zukunftsweisende Technologie einzuführen. Mit der Fortsetzung des Anlagenbetriebes können darüber hinaus nun Langzeiterfahrungen gesammelt werden.
Projektpartner:
- Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG
Einsatz der Membrantechnik zur Abwasserbehandlung auf Binnenschiffen - Abschluss: 2004
Gefördert durch:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen (MUNLV NRW)
Projektlaufzeit:
April 2002 - Dezember 2004
Inhalt:
Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen (MUNLV NRW) wurde im Zeitraum April 2002 bis Dezember 2004 am Institut für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH
Aachen (ISA) und am Prüf- und Entwicklungsinstitut für Abwassertechnik an der RWTH Aachen e.V. (PIA) die Einsatzfähigkeit der Membrantechnik zur Abwasserbehandlung auf Fahrgastbinnenschiffen untersucht.
Inhalte des F+E-Vorhabens „Einsatz der Membrantechnik zur Abwasserbehandlung auf Binnenschiffen“ (AZ IV-9-042 528) waren Entwicklung und Test von Abwasserbehandlungsanlagen für Binnenschiffe mit Membrantechnologie, basierend auf einer Kombination des aeroben Belebungsverfahrens und der Mikrofiltrationstechnik zur Abtrennung des Belebtschlamms.
Ziel dieses Projektes war es, die Abwasserreinigung an die schiffsbaulichen und betrieblichen Rahmenbedingungen anzupassen und so den Schifffahrtsunternehmen eine geeignete Verfahrenstechnik zur Behandlung der anfallenden Abwässer an Bord zur Verfügung zu stellen.
Projektpartner:
- Institut für Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen (ISA)
- Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG
- Delphin Umwelttechnik GmbH, Hamburg
- Earth Tech Umwelttechnik GmbH, Neuss
- Martin Systems Engineering GmbH, Sonneberg
- Puron AG, Aachen
Erarbeitung eines Prüfverfahrens für Bordkläranlagen für Binnenschiffe gemäß den Anforderungen der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) - Abschluss: 2008
Gefördert durch:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV)
Projektlaufzeit:
April 2008 – Juli 2008
Inhalt:
Das Image als umweltfreundlicher Verkehrsträger sowie ein allgemein gestiegenes Umweltbewusstsein führen dazu, dass die Binnenschifffahrt ständig bestrebt ist, alle von einem Schiff ausgehenden Emissionen bestmöglich zu reduzieren. Mit dem "Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt" der ZKR soll zukünftig im Interesse des Umweltschutzes die Behandlung aller auf einem Binnenschiff anfallenden Abfälle mit einheitlichen Vorgaben für die Mitgliedsstaaten Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Deutschland und die Niederlande geregelt werden.
Zur Umsetzung der Vorgaben zur Entsorgung an Bord anfallender häuslicher Abwässer wurde am PIA in Kooperation mit dem Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB e.V.) und Vertretern des zuständigen technischen Ausschusses der ZKR ein Prüfverfahren für Abwasserbehandlungsanlagen erarbeitet. Das Prüfverfahren soll dazu dienen, dass Abwasserbehandlungsanlagen als so genannte Bordkläranlagen eingesetzt werden können, um die häuslichen Abwässer direkt am Entstehungsort, d.h. an Bord der Schiffe, zu behandeln. Die in der Prüfvorschrift festgelegten Anforderungen (wie z.B. Mindestausstattungsmerkmale) sollen gewährleisten, dass an Bord installierte Abwasserbehandlungsanlagen schiffsspezifischen Anforderungen genügen.
Ein entsprechender Entwurf wurde im Herbst 2008 den verantwortlichen Gremien der ZKR vorgestellt. Eine Umsetzung ist aller Voraussicht nach für das Jahr 2009 vorgesehen. Das Vorhaben wurde vom Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.
Projektpartner:
- Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB e.V.)
- Zentralkommission für die Rheinschifffahrt ZKR
Erfassung der Abwasserzusammensetzung und Abwasservolumenströme auf Flusskreuzfahrtschiffen - Abschluss: 2006
Gefördert durch:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
Projektlaufzeit:
Juli 2005 bis Oktober 2006
Inhalt:
Vor dem Hintergrund, dass zukünftig mit Inkrafttreten des sogenannten Abfallübereinkommens der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt auf Flusskreuzfahrtschiffen das Einleiten von unbehandelten häuslichen Abwässern verboten wird, wurde bereits in den letzten Jahren von der Premicon AG (Mehrheitsbeteiligung an der KD) damit begonnen, Schiffsneubauten mit Schiffskläranlagen auszurüsten.
Nach knapp zwei Jahren Betriebserfahrung mit den Schiffskläranlagen musste allerdings erkannt werden, dass die installierten Anlagen nur unzureichend funktionierten und die in Zukunft an sie gestellten Reinigungsanforderungen wohl nicht erfüllen können. Die Ursache wird darin gesehen, dass zurzeit kaum Erfahrungen zur Abwasserzusammensetzung auf Fahrgastschiffen vorliegen und daher allgemein übliche Bemessungsansätze für kommunale Anlagen bei der Dimensionierung der Anlagen herangezogen wurden. Es wurde bei der Planung nicht bedacht, dass der Bordbetrieb eines Flusskreuzfahrtschiffes eher einem Hotelbetrieb als einem Haushalt gleichzusetzen ist und damit auch die Belastung eines Passagiers nicht nur einem Einwohnerwert entspricht.
Meinungsstand ist, dass die installierten Anlagen saniert werden müssen, eventuell vollständig auszutauschen sind, damit die Reinigungsanforderungen erfüllt werden können. Vor diesem Hintergrund wurde das PIA vom MUNLV beauftragt, Untersuchungen zu Abwasserzusammensetzung und –volumenströmen durchzuführen, um belastbare Bemessungsgrundlagen zu erhalten.
Erste Untersuchungen zur Abwasserbeschaffenheit auf Flusskreuzfahrtschiffen wurden Mitte November während eines Einsatzes der Schiffe als „Messehotels“ durchgeführt. Beabsichtigt ist, den Schwerpunkt der Untersuchungen auf die Fahrtsaison 2006 zu legen.
Projektpartner:
- Köln Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG, Köln
- Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) RWTH Aachen
Integration, Betrieb und Begleitung des großtechnischen Betriebes einer Membrankläranlage an Bord der MS RheinEnergie - Abschluss: 2007
Gefördert durch:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
Projektlaufzeit:
Januar 2005 bis Februar 2007
Inhalt:
Mit Inkrafttreten des "Übereinkommens über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt" der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt wird die Einleitung von an Bord anfallenden Grau- und Schwarzwässern geregelt. Es ist vorgesehen, dass für Kabinen- und Fahrgastschiffe bestimmter Größe in Zukunft ein Einleiteverbot für unbehandelte Abwässer existieren soll.
Im Rahmen dieses Projektes wurde im Jahr 2005 damit begonnen, an Bord des Tagesausflugschiffs MS RheinEnergie der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG eine großtechnische Membrankläranlage der Firma Martin Systems zu integrieren und in Betrieb zu nehmen. Die Anlage besteht aus der Vorreinigung, dem Membranbioreaktor und dem von der Firma Martin Systems entwickelten siClaro FM-Filter zur Abtrennung des gereinigten Abwassers vom belebten Schlamm. Die Vorreinigung ist als Grobabscheidung mit Feinsiebung ausgeführt. Der Membranbioreaktor ist so ausgelegt, dass Zulaufspitzen durch Variation des Füllstandes in den schiffseigenen vorgelagerten Speichertanks vergleichmäßigt werden. Treten im Zulauf zu hohe hydraulische Belastungsspitzen während des Gästebetriebes auf, ist eine Zwischenspeicherung des Abwassers möglich.
Die eingesetzten organischen, polymeren Ultrafiltrationsmembranen sind als Flachmembranen ausgeführt und in eine vom Belebungsbecken getrennten Filterkammer integriert. Die Membrankläranlage ist für einen mittleren Abwasseranfall von 35 m³/d und für den Zeitraum von 48 h für einen maximalen Anfall von 55 m³/d ausgelegt. Als mittlere Schmutzfracht wurde dabei von 16,8 kg BSB5/d ausgegangen.
Ziel der Untersuchungen ist die Ermittlung von Bemessungsgrößen zur Dimensionierung von Bordkläranlagen für Fahrgastbinnenschiffe. Die Anforderungen an Bordkläranlagen für Seeschiffe unterscheiden sich in wichtigen Details von den Anforderungen an Bordkläranlagen für Fahrgastbinnenschiffe. Beispielsweise wird gemäß der International Maritime Organisation (IMO) nur Schwarzwasser als Abwasser definiert, dass auf Seeschiffen zu behandeln ist, während die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt auch Grauwasser zu behandelndes Abwasser bezeichnet. Damit können bisherige Bemessungsgrundlagen für Bordkläranlagen, die aus der Seeschifffahrt stammen, nur bedingt in die Binnenschifffahrt übertragen werden.
Durch eine kontinuierliche Erfassung der Wasserverbrauchsmengen und Beprobungen der Abwasserzusammensetzung sollen die notwendigen Bemessungsgrößen ermittelt werden. Berücksichtigt werden sollen dabei sowohl Linien- wie auch spezielle Veranstaltungsfahrten.
Projektpartner:
- Köln Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG, Köln
- Martin Systems GmbH Engineering
- Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) RWTH Aachen
Nachhaltige Aufbereitungstechnologien zur Abwasserreinigung & -wiedernutzung auf Kreuzfahrtschiffen (NAUTEK) - Abschluss: 2016
Gefördert durch:
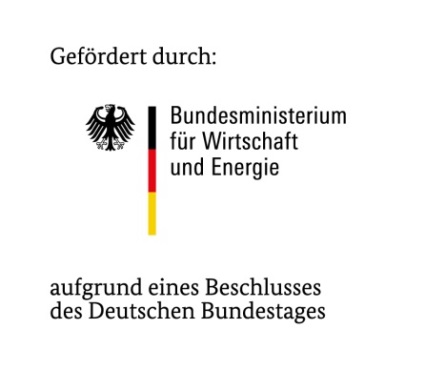
im Förderprogramm: „Maritime Technologien der nächsten Generation”
Projektlaufzeit:
Juli 2013 – Juni 2016
Inhalt:
Veranlassung und Zielsetzung:
Kreuzfahrten haben sich zu einer beliebten Reiseform entwickelt und zählen zu einem der dynamischen Wachstumsmärkte in der Tourismusindustrie. Derzeitig sind weltweit rund 300 Kreuzfahrtschiffe mit einer Kapazität von knapp 400.000 Betten im Einsatz. Das stetige Wachstum dieser Branche führt in den letzten Jahren dazu, dass die von Kreuzfahrtschiffen ausgehenden Emissionen verstärkt in den Blickpunkt rücken. Insbesondere Passagiere, die zunehmend sensibilisiert sind für die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, verlangen nach Angeboten, die eine möglichst geringe Umweltbelastung verursachen. In der Gesamtschau werden die Emissionen von Kreuzfahrtschiffen heute insgesamt noch als zu hoch eingestuft, so dass alle Akteure bestrebt sind, die Umweltbilanz von Kreuzfahrtschiffen stetig zu verbessern.
Das Verbund-Projekt NAUTEK beleuchtete die aktuelle Praxis der Abwasseraufbereitung auf Kreuzfahrtschiffen mit dem zentralen Ziel, ein umfassendes und innovatives Abwasserwiedernutzungskonzept für Kreuzfahrtschiffe zu entwickeln und hierfür geeignete Technologien zu erproben und zu etablieren. Der Arbeitsschwerpunkt am PIA umfasste Untersuchungen von an Land etablierten und bewährten Verfahren zur Kohlenstoff- und Nährstoffelimination und deren Modifikation für einen maritimen Einsatz vor dem Hintergrund erstmalig eingeführter nährstoffspezifischer Umweltvorgaben für die Einleitung bordseitig behandelter Schiffsabwässer. Zukünftig sind Schiffskläranlagen für Kreuzfahrtschiffe damit anders als bisher zur Nährstoffelimination auszulegen. Mit den heute an Bord genutzten Abwasserreinigungstechnologien können oftmals diese strengeren Anforderungen nicht eingehalten werden, so dass es verfahrenstechnische Weiterentwicklungen für den Schiffseinsatz bedarf.
Es wurden insbesondere für die Stickstoffelimination umfassende experimentelle Untersuchungen an Land und an Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAsol zur vorgeschalteten und intermittierenden Denitrifikation unter Einsatz von Versuchsanlagen mit Membrantechnologie durchgeführt.
Ergebnisse:
Durch die Mitwirkung im Projekt wurde ein entscheidender Beitrag zu Schiffskläranlagen für Kreuzfahrtschiffe als innovatives maritimes Produkt geleistet. Im Rahmen einer Kooperation von Forschung und Wirtschaft wurde der deutsche Anlagenbauer Martin Membrane Systems dabei unterstützt, seine Position im internationalen Markt zu stärken. Gleichzeitig konnten die Kompetenzen am PIA zu den Themen Schiffsabwasser und Schiffsabwasserbehandlung ausgebaut und wichtige praxisbezogene Erkenntnisse gewonnen werden, die die Beraterkompetenzen am PIA im Bereich Umweltconsulting erhöhen. Mit diesem Zugewinn geht gleichfalls eine Sicherung von Arbeitsplätzen am PIA in den Zukunftsmarkt maritimer Umwelttechnologien mit ein.
- Die Testphasen mit der Landversuchsanlage führten zu der Erkenntnis, dass sich aufgrund der schiffsspezifischen Abwasserzusammensetzung vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten ergeben. Die üblicherweise hohe organische Belastung von Schiffsabwasser ermöglichte es, beide Reaktoren der Landversuchsanlage mit identischen Funktionen zur anoxischen und aeroben Behandlung und der Membranfiltration zur Phasentrennung zu konfigurieren. So führte der Betrieb der Spülgebläse der Membranfiltration zu keiner Störung der im Reaktor parallel ablaufenden Denitrifikationsprozesse, so dass eine zeitliche Abstimmung von Behandlungs- und Filtrationsabläufen nicht erforderlich war. Diese hohe Flexibilität kann insbesondere Nachrüstungen deutlich erleichtern, wenn keine separaten Reaktoren für Behandlungs- und Filtrationsprozesse vorgesehen werden müssen. Mit den Untersuchungen an Land konnten damit wichtige Erkenntnisse für Nachrüstungen erzielt werden, die sich auch in Neubauten umsetzen lassen.
- Die Betriebsbegleitung der Versuchsanlage von Martin Membrane Systems an Bord der AIDAsol führte zu einem deutlich verbesserten Verständnis hinsichtlich der Abwassersituation auf Kreuzfahrtschiffen und den daraus resultierenden Herausforderungen zum Abwassermanagement an Bord. Insbesondere verdeutlichte der Bordbetrieb des Demonstrators die hohen Differenzen zwischen den standardisierten Bedingungen des Zulassungstests und den Anforderungen später im realen Betrieb. Gemeinsam mit den Landuntersuchungen zeigte sich, dass Anlagenparametrierungen für den Zulassungstest nicht zwangsläufig für den späteren Realbetrieb geeignet sind. Als Konsequenz für das Anlagendesign resultieren daraus Anforderungen an flexible und anpassbare Betriebsweisen, insbesondere was die Wahlmöglichkeiten für die aerobe und anoxische Abwasserbehandlung hinsichtlich der Stickstoffelimination betrifft. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen sollten auf rein anoxisch zu betreibende Reaktoren verzichtet werden und alle Behandlungsreaktoren mit Umwälz- oder Belüftungsgebläse ausgerüstet werden.
- Das Verfahren der intermittierenden Denitrifikation mit simultaner Phosphorfällung stellt ein vorteilhaftes Verfahren für die weitergehende Abwasserbehandlung an Bord von Kreuzfahrtschiffen dar. Gegenüber dem Verfahren der vorgeschalteten Denitrifikation liegt der Vorteil darin, dass unterschiedliche Behandlungsschritte nicht räumlich getrennt in verschiedenen Behandlungsreaktoren sondern zeitlich voneinander getrennt in einem Behandlungsreaktor erfolgen. Damit liegen deutlich verbesserte Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Abwassersituationen vor. Auf Basis der durchgeführten Untersuchungen an Bord wurden Eliminationsraten in Bereichen von bis zu 90% für die Parameter Stickstoff und Phosphor erzielt.
- Die wissenschaftlichen Begleitungen an Bord der AIDAsol haben zu einem deutlich verbesserten Verständnis und zu einer ausgeprägten Sensibilisierung gegenüber den an Bord vorherrschenden Betriebsbedingungen und den daraus resultierenden Anforderungen an die Verfahrenstechnik und eingesetzten Komponenten geführt. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen wird zum jetzigen Zeitpunkt ein hoher Technisierungsgrad von Schiffskläranlagen favorisiert, der aufgrund seiner Automation zur Entlastung des Bordpersonals (manueller Aufwand Anlagenüberwachung und –betrieb) entscheidend beitragen könnte. Die fachliche Qualifikation der für die Schiffskläranlagen verantwortlichen Personen an Bord ist von entscheidender Bedeutung. Regelmäßige Schulungen für dieses Personal werden empfohlen.
- Als Ergebnisverwertung ist u.a. geplant, das Prüfverfahren für Schiffskläranlagen auf Kreuzfahrtschiffen kritisch zu durchleuchten und Prüf-Alternativen zu erarbeiten. So könnten bereits im Vorfeld zum späteren Schiffseinsatz relevante Punkte abgefragt werden, die später an Bord von Bedeutung sein werden. Dazu zählt insbesondere die deutlich höhere Belastung mit organischen Stoffen von realen Schiffsabwässern gegenüber dem im Prüfverfahren eingesetzten Testabwasser.
Projektpartner:
- Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz der Technischen Universität Hamburg-Harburg (aww)
- Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen aus Hamburg (CML)
- AIDA Cruises
- Martin Membrane Systems AG
- MAHLE Industriefiltration GmbH
- Meyer Werft
- Blohm + Voß Repair
- Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft
- Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik
Untersuchung zur Leistungsfähigkeit von Bordkläranlagen mit Membrantechnik und Optimierung des Anlagenbetriebs an Bord von Flusskreuzfahrtschiffen - Abschluss: 2012
Gefördert durch:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück
Projektlaufzeit :
Februar 2011 – Mai 2012
Inhalt:
Anlass des Vorhabens war die zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes in der europäischen Binnenschifffahrt, wobei die Entsorgung häuslicher Schmutzwässer von Fahrgastbinnenschiffen verstärkt in den Fokus getreten ist. Ziel des Projektes war es, die Leistungsfähigkeit von Membranbordkläranlagen auf Flusskreuzschiffen zu untersuchen.
Im Rahmen des Projektes wurden an Bord von zwei Flusskreuzfahrschiffen der Betrieb von Membranbordkläranlagen begleitet. Die Untersuchungen erfolgten während mehrtägiger Messphasen und Einzelmessungen. Anlagensteuerung und -überwachung oblagen dem Betriebspersonal. Untersucht wurden Membranbelebungsanlagen vom Typ BMA® 300 des Projektpartners Martin Systems AG. Zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit wurden Zu- und Ablauf der Membranbordkläranlage beprobt. Weitere Betriebsdaten wurden mit Hilfe der Anlagensteuerung erfasst.
Projektpartner:
- Martin Systems AG