F&E Infrastruktur
Infrastruktur
SMART-MOVE - Integrated Water Resources Management (IWRM) - Abschluss: 2018
Gefördert durch:
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Inhalt:
SMART-MOVE is the follow-up and implementation phase of the preceding SMART I and SMART II projects, which aimed at developing a transferable approach for Integrated Water Resources Management (IWRM) in the Lower Jordan Valley.
This region that is shared by Jordan, Israel, and the Palestinian Territories is characterized in general by water scarcity and has a long-term history of political tensions.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.iwrm-smart-move.de
Projektpartner:
Al-Balqa Applied University, Salt
Al-Quds University, Department of Earth & Environmental Sciences, Jerusalem
Arab Technologist for Economical and Environmental Consultation (ATEEC), Amman
ATB Umwelttechnologien GmbH, Porta Westfalica
Bauer Umwelt GmbH, Schrobenhausen
Bildungs- und Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung – BDZ e. V., Leipzig
disy Informationssysteme GmbH, Karlsruhe
DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut, Karlsruher Institut für Technologie
Environmental & Water Resources Engineering, Haifa
Georg-August-Universität Göttingen, Geowissenschaftliches Zentrum, Angewandte Geologie
HEC – Hydro-Engineering Consultancy, Al-Bireh
Helmholtzzentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ, Umwelt- und Biotechnologisches Zentrum (UBZ), Leipzig
Jordan University, Amman
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Angewandte Geowissenschaften, Abteilung Hydrogeologie
Mekorot Water Company Ltd., Tel Aviv
Ministry of Agriculture, Al-Bireh
Ministry of Water and Irrigation, Amman
NAW – Nabil Ayoub Wakileh & Co., Amman
Palestinian Hydrology Group, Ramallah
Palestinian Water Authority, Ramallah
Rusteberg Water Consulting UG (RWC), Göttingen
SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG, Kaufbeuren
Tel Aviv University, Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv
Aufbau des BDZ - Bildungs- und Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung (Leipzig) - Abschluss: 2006
Gefördert durch:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück
Projektlaufzeit:
Mai 2003 bis Mai 2006
Inhalt:
Das Arbeitspaket Schulung und Ausbildung umfasst die praxisnahe Durchführung von Ausbildungsinhalten im Bereich der dezentralen Abwasserbehandlung. Bei der Berücksichtigung der nationalen und länderspezifischen Rahmenbedingungen soll bundesweit ein anerkanntes Prüfwesen für Schulungskurse aufgebaut werden. Ein Modellversuch zwischen einzelnen Bundesländern ist angedacht. Eine Ausweitung auf internationaler Ebene ist geplant.
Bis jetzt wurden Schulungsangebote für einen Kurs "Kleinkläranlagenwartung in Theorie und Praxis" erstellt.
Bestehende Weiterbildungsmaßnahmen anderer Institutionen in diesem Segment führten zu Kooperationen, um die Entwicklung weiterer unterschiedlicher Schulungskonzepte zu vermeiden.
www.bdz-abwasser.de
Projektpartner Arbeitspaket Schulung:
- Haus der Umwelt e.V., Leipzig
- Umweltforschungszentrum Leipzig
Aufbau eines Beratungszentrums für dezentrale Abwasserentsorgung - Abschluss: 2007
Gefördert durch:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück
Projektlaufzeit:
Mai 2005 bis April 2007
Inhalt:
Durch ein überregionales und unabhängiges Informations-, Beratungs- und Mediationszentrum sollte der Mangel an Informationen im Bereich der dezentralen Abwasserentsorgung behoben werden.
Es galt allen Zielgruppen einen einheitlichen Stand der Auskünfte in neutraler Form zu garantieren, zwischen Parteien zu vermitteln, zuständige Behörden in Bezug auf Nachfragen zu entlasten und bei Konflikten eine Mediatorenrolle zu übernehmen. Gesetzliche Anforderungen, rechtliche Aspekte, technische Möglichkeiten und Rahmenbedingungen des Anlagenbetriebes sollten die relevanten Informationen für Investitionsentscheidungen und die Genehmigungspraxis sein. Die Auskünfte/Beratung sollte adressatengerecht in Form von Schriften, Informationsveranstaltungen, Telefonaten und über das Internet erfolgen.
Der Aufbau des Beratungszentrums gliederte sich in zwei Phasen:
Die erste Phase (Förderung 24 Monate) diente dem Aufbau des Beratungszentrums. Dies umfasste die Informationssammlung, Dokumentation und Aufbereitung von Informationen / Daten sowie die Entwicklung und den Aufbau eines umfangreichen Internetangebots. Die Aufbauphase gliederte sich in zwei Teile: In den ersten 12 Monaten stand der Aufbau des Beratungszentrums sowie die Sammlung und Aufbereitung der Informationen im Vordergrund (inkl. Internetpräsenz). Im Folgejahr war eine regionale Vertiefung in den Bereichen Bezirksregierung Köln und Regierungspräsidium Leipzig, die Erarbeitung von Referenzfällen sowie die Vorbereitung eines zielgruppenspezifischen Informations-, Beratungs- und Mediationsangebots für Betreiber von Kleinkläranlagen vorgesehen.
Die zweite Phase beinhaltete die Fortführung der Arbeiten (einschließlich Weiterbildung) durch Eigenfinanzierung aus den Projektaktivitäten.
Projektpartner:
- Haus der Umwelt e.V., Leipzig
- Institut für Umweltschutz in der Berufsbildung e.V., Hannover
Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen - Abschluss: 2015
Gefördert durch:
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
Projektlaufzeit:
03.2015-12.2015
Inhalt: Mit der Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union einheitliche Anforderungen zur Reinigung von kommunalem Abwasser festgelegt. Die Richtlinie definiert Anforderungen an die Kanalisation, Einleitungen aus kommunalen Kläranlagen, die Mischwasserbehandlung und industrielles Abwasser. Sie stellt gleichzeitig einen Mindestumfang der Überwachung von Abwassereinleitungen sicher. Die Richtlinie sieht außerdem vor, dass alle zwei Jahre ein Lagebericht zum aktuellen Stand der Abwasserbeseitigung erstellt und veröffentlicht werden muss. Dieser Lagebericht informiert über die Entwicklung und den Stand der Abwasserbeseitigung und dokumentiert die erfolgte Umsetzung der EU-Richtlinie.
Bezogen auf Nordrhein-Westfalen bilden die Genehmigungs- und Überwachungstätigkeit der Umweltverwaltung die Datenbasis für den Bericht, der auch eine wesentliche Grundlage für umweltpolitische, wasserwirtschaftliche und behördliche Entscheidungen darstellt. Im Fokus steht die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Gewässer sollen ökologisch intakt sein, einen guten chemischen Zustand aufweisen und sich als Rohwasser für die Trinkwassergewinnung bestens eignen. Derzeit sind noch weniger als 10% der Oberflächengewässer in einem guten ökologischen Zustand. Für die notwendige Verbesserung der Gewässer und zur Erreichung der bundesgesetzlich vorgegebenen Ziele ist es folglich erforderlich, die bisherigen Anstrengungen zu verstärken. Für die Abwasserbeseitigung liegt mit der vorliegenden Veröffentlichung eine wesentliche Grundlage für die anstehende Maßnahmenplanung vor.
Projektpartner:
- Institut für Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen (ISA)
- Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW)
Erstellung eines Baseline Szenarios für die Entwicklung der punktuellen Einträge in die Flussgebiete in NRW - Abschluss: 2004
Gefördert durch:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV)
Projektlaufzeit:
06.2004-09.2004
Inhalt:
Die Bestandsaufnahme der Einleitungen bzw. Einträge aus Punktquellen erfolgt für Nordrhein-Westfalen über die Datendrehscheibe-Einleiterüberwachung-Abwasser (DEA), die den Austausch und die Auswertung der Datenbanken des Landes, wie beispielsweise von Kläranlagen, Industrieanlagen und Regenbecken, ermöglicht. Die Bestandsaufnahme ist die Voraussetzung für eine effiziente und ökonomische Maßnahmenplanung im Rahmen der Umsetzung der WRRL. Die Auswertung der Datenbanken bezieht sich bei Kläranlagen und Industrieeinleitern auf Überwachungswerte. Die Berechnung der Niederschlagswassereinleitungen und der Einleitungen aus Kleinkläranlagen bzw. der dadurch bedingten Emissionen beruht derzeit nur auf einem Schätzverfahren, da flächendeckende Messdaten nicht vorliegen und auch in naher Zukunft nicht verfügbar sein werden.
Neben der Betrachtung des derzeitigen Standes der Abwasserentsorgung ist auch die künftige Entwicklung der punktuellen Einträge interessant. Voraussichtlich signifikante Änderungen und Entwicklungen der nächsten Jahre sollen als wesentliche Elemente der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in die Risikoanalyse integriert werden [BMU; 2003]. Im Rahmen der Risikoanalyse sollen dann die Wasserkörper bestimmt werden, für die die Erreichung der Umweltziele der WRRL gefährdet ist.
Um eine Prognose der Entwicklung der punktuellen Einträge zu tätigen, soll ein Baselineszenario für das Jahr 2015 aufgestellt werden, das die zum Ende des ersten Flussgebiets-Managementzklus zu erwartenden Rahmenbedingungen skizziert. Dazu müssen die Einflussfaktoren auf die Entwicklung der gesammelten und in die Gewässer eingeleiteten Abwasservolumenströme bestimmt und qualitativ und quantitativ bewertet werden.
Projektpartner:
- Institut für Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen (ISA)
- Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW)
- Prognos AG
Erweiterung des Fachinformationssystems FlussWinIMS - Abschluss: 2006
Gefördert durch:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
Projektlaufzeit:
August 2005 bis Oktober 2006
Inhalt:
Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz MUNLV beauftragte im Juni 2004 die RWTH Aachen und das Büro Keck Informationstechnologie (KIT) mit dem Projekt KARO “Konzeption, Entwicklung und Aufbau eines Geoinformationssystems zur Beurteilung der Emissionen und Immissionen von Oberflächengewässern - Entwicklung geeigneter Auswerteroutinen und Integration in das Fachinformationssystem FlussWinGIS“. Bei diesem Projekt werden umfangreiche quantitative und qualitative Auswertungen erarbeitet und in das Fachinformationssystem FlussWinGIS integriert. FlussWinGIS stellt auf ArcView 8-Basis den Expertenarbeitsplatz für die Mitarbeiter der Wasserwirtschaftsverwaltung NRW, Bereiche Abwasser und Oberflächengewässer, zur Verfügung. Im Laufe des Projektes KARO hat sich gezeigt, dass ein wesentlich höherer Bedarf der Wasserwirtschaftsverwaltung an Informationen zu Abwasser und Oberflächengewässer besteht, als er durch die Expertenarbeitsplätze von FlussWinGIS gedeckt werden kann. Daher regte das MUNLV an, das Projekt KARO um die Weiterentwicklung der Web-Version FlussWinIMS zu erweitern. Fluss-WinIMS wurde als Web-basierte Intranetlösung zusätzlich zu der Expertenversion FlussWinGIS entwickelt und stellt als Auskunftsarbeitsplatz Teilbereiche der Daten und Auswertungen aus FlussWinGIS zur Verfügung.
FlussWinIMS besteht aus 2 Teilprogrammen, zum einem der Visualisierungskomponente IMS (Internet Mapping server von ESRI), zweitens aus einer von KIT entwickelten Applicationsserverlösung WO (WebOb-jects), die für die Datenbankzugriffe, die Auswertungen und für die Aufbereitung der Datenblätter (Reports) zuständig ist.
Das Vorhaben sieht vor, die Browserbasierte Intranetlösung FlussWinIMS so zu erweitern, dass den Anwendern in der Wasserwirtschaftsverwaltung NRW ein großer Teil der FlussWinGIS-Anzeige- und Auswertungsfunktionalitäten zur Verfügung gestellt wird, ohne dass sie FlussWinGIS mit ArcView 8 und einen ODBC-Zugang zur zentralen Datenbank D-E-A am Arbeitsplatz verfügbar haben müssen.
Projektpartner:
- Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) RWTH Aachen
- Keck Informationstechnologie (KIT), Schwetzingen
POSDRU-Projekt in Rumänien - Abschluss: 2014
Supported by:
The project is financed by the European Social Fund under the program "Human Resources Development 2007 - 2013" (Romanian: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - POSDRU).
Duration of the project:
04.2011-03.2014
Content:
In April 2011 the project "Preparation of specialists in mechanics, hydraulics and pneumatics in order to promote adaptability and increase competitiveness" started.
The main objectives of the project are:
- Organizing, equipping and operation of four regional centres for training in mechanics, hydraulics and pneumatics in Romania (see map)
- Coaching professional trainers, experts for professional counseling and employees
- Providing training in mechanical and hydro-pneumatic applications as well as labour safety and environmental management
The professional training courses for hydraulics and pneumatics will be organized on 2 levels, one according to the national standards settled and the second being made in conformity with the indications of CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques), the European professional association.
The main activities of PIA in this project are:
- International exchange of experience
- Participate in developing analysis studies, training methodology and material as well as monitoring systems of the training activities
- Organizing visits of the Romanian specialists to German and other European training centres
- Participate in conferences, pilot trainings, courses and a tutorial class for counseling
Project partners:
- Chamber of Commerce and Industry Valcea (1)
- Professional Association of Hydraulics and Pneumatics of Romania
- Fluidas in Bucharest(2)
- Technical University of Cluj-Napoca (3)
- Technical University "Gheorghe Asachi" in Iasi (4)
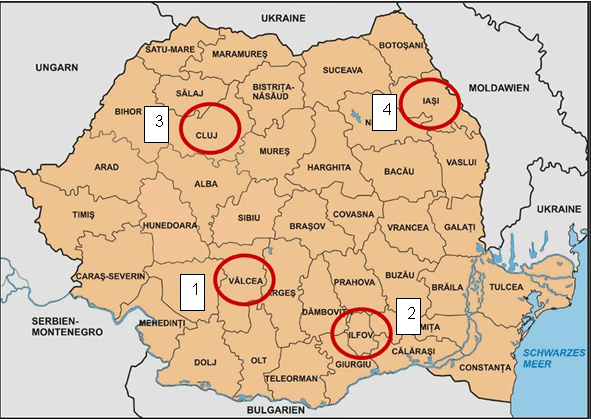
Terra Preta und das Betreibermodell - Schließung von Kreisläufen in der dezentralen Abwasserreinigung - Abschluss: 2013
Gefördert durch:
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)
Projektlaufzeit:
11.2011-02.2013
Inhalt:
Im Regenwald am Amazonas gibt es, neben den weitgehend nährstoffarmen Böden, Vorkommen an humusreichen, nachhaltig fruchtbaren Böden, die als Terra Preta (portugiesisch für "schwarze Erde") oder auch als Indianerschwarzerde bezeichnet werden.
Wesentliche Merkmale von Terra Preta sind hohe Humus- und Nährstoffgehalte sowie ein hoher Anteil an pyrogenem Kohlenstoff. Terra Preta kann sowohl künstlichen als auch natürlichen Dünger weitestgehend ersetzen. Da Klärschlamm aus zentralen Anlagen ein geringes Aufkommen an unerwünschten Stoffen, wie z.B. Schwermetallen aufweist, sind bei Klärschlamm aus dezentralen Anlagen gute Voraussetzungen als Ausgangspunkt für ein Kultursubstrat gegeben. Seit November 2011 wird das vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) finanzierte Projekt "Terra Preta und das Betreibermodell" durchgeführt.
Im Projekt „Terra Preta und das Betreibermodell“ wurde die prinzipielle Eignung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen zur Herstellung eines Kultursubstrats unter Beigabe von Zusatzstoffen (Terra Preta) untersucht. Darüber hinaus wurde ein Konzept für die großtechnische Herstellung von Terra Preta entwickelt. Das Projekt wurde vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) finanziert.
Im Rahmen der Projektarbeit wurden durch den PIA e.V. Klärschlamm- und Substratproben sowie filtrierte Klärschlammproben, die als Grundlage für die Substratherstellung dienten, untersucht. Bei den Klärschlammproben handelte es sich um Mischproben aus sechs verschiedenen Kleinkläranlagen im Verbandsgebiet des AZV Leisnig. Zur Herstellung des Substrats wurde dem filtrierten Klärschlamm Holzkohle, Sägespäne, Weizenkleie, Bentonit und Gesteinsmehl beigemischt. Des Weiteren wurde dieses Substrat drei Wochen fermentiert. Die Analysen der Schlamm- und Substratproben umfassten nach Klärschlammverordnung (AbfKlärV) §3 (5) folgende Parameter:
• Allgemeine Parameter: Trockensubstanz, organische Substanz, mineralische Substanz, pH-Wert
• Nährstoffe und Nebenbestandteile: Gesamtstickstoff, Ammonium, Phosphat, Kaliumoxid, Calciumoxid, Magnesiumoxid, Schwefel, basisch wirksame Bestandteile
• Schwermetalle: Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink
• AOX
Die Schwermetallkonzentrationen lagen größtenteils weit unterhalb der Grenzwerte der Klärschlamm- und der Düngemittelverordnung. Jedoch wurde bei zwei Klärschlammproben der Grenzwert für Quecksilber der Düngemittelverordnung überschritten.
Im Hinblick auf die Nährstoffgehalte ist der untersuchte Schlamm für eine landwirtschaftliche Verwertung geeignet. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist von einem hohen Potential für die Herstellung eines Kultursubstrates auszugehen. Für eine Einordnung gemäß Düngemittelverordnung sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich.
Projektpartner:
- Tilia Umwelt GmbH
- Bildungs- und Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung – BDZ e.V.
- Institut für Bakteriologie und Mykologie der Universität Leipzig
- Abwasserzweckverband Leisnig (AZV)
- PETERSEN HARDRATH Rechtsanwälte Steuerberater
- alles klar GmbH


